

17.11.13
Pireins Auftraggeberin war mit der
Familie befreundet und der Kück fragte bei der Familie Stern um Rat. Auch
er wollte wissen, wie er sich in Zukunft verhalten müsse, um seinen
Betrieb, seine Familie und seine eigenen Interessen zu schützen, denn er
erkannte sehr wohl, dass es nicht nur um die Pferde ging. Seine Freunde,
seine Beziehungen begannen zu bröckeln, weil jemand seinen Ruf schädigte.
Herr Stern, der Vater von Stefanie, riet ihm sich zu engagieren, sich in
den Vereinen stark zu machen und Positionen mit Familienmitgliedern zu
besetzen.
Die Sterns hatten sich beratschlagt.
Sie vermuteten, dass irgendetwas passiert sein musste in der Nacht, als
Pirein auf Tropos und Triban aufgepasst hatte. Es wunderte sie, dass die
beiden einen ganzen Tag in Trance gewesen zu sein schienen. Damit hatten
sie nicht gerechnet. Sie konnten Pirein den Gebrauch von Betäubungsmitteln
nicht nachweisen, aber sie vermuteten, dass genau dieses geschehen war.
* * *
Kück besprach sich mit seiner Frau.
Sie meinte, sie wäre doch im Tennisverein und engagierte sich dort
bereits. Es konnte dennoch nichts schaden, wenn sie versuchte im Vereinsstübchen zu kellnern, sagte Kück. Er wusste, dass
seine Frau die Arbeit gerne machen würde und dem Ruf der Familie würde
es nicht schaden, da eine Kellnerarbeit in einem Sportverein nicht
gleichzusetzen war mit einer Kellnerarbeit in einer Kneipe. Man wollte
sich nicht direkt um den Vereinsnachwuchs kümmern, weil inzwischen
Stimmung gemacht wurde gegen Eltern, die ihre Kinder mit Ohrfeigen
bestrafen. Die Familie Kück hatte davon gehört und fühlte sich auch
angesprochen.
Die Art der Bestrafung und der Druck
von außen hatten innerhalb der Familie schon zu Spannungen geführt. Es
kam zu grundsätzlichen Auseinandersetzungen zwischen Kück und seiner
Frau, die aber meinte, sie hätte das alleinige Recht über die Erziehung
ihrer Kinder zu bestimmen. Das Gesetzbuch gab ihr 1970 in sofern Recht,
dass Eltern in ihrer Erziehung durchaus zur Prügelstrafe berechtigt
seien. Die Mutter hatte im Tennisverein deswegen sogar mit einem Anwalt
gesprochen. Trotzdem wollte sie sich Mühe geben, die eignen Kinder nicht
mehr mit einem schnellen Klaps zur Vernunft zu bringen, sondern auf ausführliche
Gespräche zu setzen.
* * *
Pirein erkannte das Vorhaben zu spät.
Zwar war er im Tennisverein ebenfalls nicht untätig und die
Stimmungsmache ging von ihm aus, aber als die Mutter sich mit
Schokoladenkuchenbacken und Vernunftgesprächen wieder Freunde machte und
plötzlich im Vereinsgasthaus kellnerte, war er von der Situation überrascht.
Sie konnte sich ihm in den Weg stellen, dies begriff er. Zudem war sie nicht auf den Mund gefallen und er hatte Schwierigkeiten ihren Äußerungen etwas entgegenzusetzen. Wenn sie nun ihre Kinder nicht mehr züchtigen würde, würde er über kurz oder lang seinen Respekt vor den Tennisvereinsmitgliedern verlieren.
Pirein setzte auf Ehrgeiz. Er versuchte
die Mitglieder anzuhalten, Wettkämpfe auszutragen, sich die Spiele zu
eigen zu machen und sich in den Regeln auszukennen. Er suchte sich in den
Materialien, die für den Sport geeignet
waren, die neuesten und teuersten aus und begann zu spielen wie ein
Besessener. Er wollte sein Ansehen durch Gewinnerfolge aufbessern, so dass
ihm niemand an das Zeug flicken konnte. Da bestellte ihn die
Auftraggeberin zu sich.
* * *
Stefanie Stern fragte ihn nun plötzlich,
warum er die Familie Kück denn nicht in Ruhe lasse. Er habe sein Geld
doch bekommen und könne sich doch nun ein paar schöne Jahre hier in der
Kleinstadt machen. Den Wirbel den er jetzt mache, wolle sie gar nicht.
Pirein dachte nicht daran, klein beizugeben. Er bohrte nach. „Warum
haben sie mir denn dann den Auftrag gegeben?“ Steffi entgegnete, dass
dies ihre Sache sei.
Als Pirein aber verlangte, dass dann
auch das Versprechen, welches er gegeben habe zurückgenommen werde, sagte
sie Nein. Er sollte also bleiben und sich um nichts kümmern?
Pirein war fassungslos. Er verstand nicht, wie man sein Geld so verschleudern könne. Als sie ihn also nochmals bat, die Familie in Ruhe zu lassen und sich aus allem heraus zu halten, entgegnete er: „Ich kann nicht.“ Sie fragte; „Wieso?“ Er antwortete: „Ich bin Zeuge und ich glaube sie verheimlichen mir etwas.“
Sein letzter Satz war eine Anspielung
auf die konfessionellen Verhältnisse, die in der Region von Welkostadt
vorherrschten und zugleich sein eigenes Glaubensbekenntnis.
Die meisten Leute der Umgebung waren
katholisch. Sie waren brave Leute, die ehrfürchtig an die Kirche glaubten
und gerne die Kirche als ein Bollwerk betrachteten. Es gab eine große
Gruppe evangelischer Menschen, die aber zumeist zugezogen waren. Die Dörfer
waren nach dem Krieg angefüllt worden mit Flüchtlingen. Die Familie Kück
war ebenfalls aus diesem Grund zusammengekommen. Sie waren evangelisch.
Der Vater war mit seinen Eltern aus der Umgebung von Dresden geflohen, die
Mutter mit ihren Eltern stammte aus Hamburg.
Pirein war jedoch Zeuge Severins und fühlte sich genötigt, seinen Glauben in der Stadt verbreiten zu dürfen. Dazu gehörte auch, dass er es sich nicht nehmen lassen wollte, über andere Menschen zu urteilen, denn die Zeugen nahmen für sich in Anspruch nach eigenen Gesetzen Recht zu sprechen.
„Nun gut, wir werden sehen!“ sprach
seine Auftraggeberin. Pirein bettelte: „Sagen sie mir doch endlich den
Grund, warum sie mich angeworben haben!“ „Ich kann nicht!“
entgegnete Stefanie Stern. „Wieso?“ drang Pirein darauf, eine Antwort
zu erhalten. „Die
Alliierten sitzen mir im Nacken.“ Er
lachte zuerst glucksend, doch dann verstand er die Bedeutung dieser
Aussage. Sie hatte ihn soeben an die Erlebnisse seiner Kindheit erinnert.
Sie sah ihn scharf an und sprach: „Ich habe nun zu Arbeiten. Bitte
verlassen sie meine Räumlichkeiten.“ Sie entließ ihn und rot vor Zorn
lief er davon.
* * *
Er machte sich nun wieder an die Aufgabe, die er für den Bestimmungszweck seines Daseins hielt. Er suchte nach Gründen die Familie in Misskredit zu bringen.
Im Tennisverein spielte er die Rolle des ehrgeizigen Gewinners weiter. Als die Mutter im Vereinsstübchen kellnerte, kam er auf den Tennisplatz. Er spielte sein Match und ging in einer Pause zu Frau Kück. Auf dem Platz hatte er bereits einen Satz verloren und er markierte mit Absicht den Sterbenden. „Ich habe solche Kopfschmerzen!“ klagte er. Er bat nun Magdalene Kück, ihm etwas gegen seine angeblichen Schmerzen zu bringen: „Können Sie mir bitte etwas gegen meine Kopfschmerzen bringen? – In einem Glas mit Wasser.“
Freundlich und besorgt löste Magdalene Kück ein Aspirin in einem Glas Wasser auf und brachte es ihm an den Tisch, wo Pirein leidend saß. Er trank es und ging wieder dem Spiel zu. Er verlor das Match und kam zurück an den Tresen. Lautstark brüllte er herum: „Was haben Sie mir in das Glas getan. Ich habe kaum noch spielen können. Ich verlange zu wissen, womit sie mich vergiftet haben!“ Sie war zunächst sprachlos. Dann sagte sie: „Aspirin, Herr Pirein. Und ich kann nichts dafür, wenn sie nicht mehr geradeaus gucken können.“ „Ich werde sie anzeigen! Ich habe nach Wasser verlangt!“ rief er aus und verließ böse den Platz.
Darauf hatte er es angelegt, denn er
wollte einen Grund, konkreter gegen die Familie vorzugehen. Tatsächlich
erstatte er sofort eine Anzeige. Man lachte ihn zwar bei der Polizei in
Welkostadt aus, und hielt ihn wieder einmal für einen Neurotiker, aber
damit rechnete er. Dennoch musste die Polizei die Anzeige aufnehmen und
der Verdacht einer bösen Absicht war gelegt.
* * *
Ein paar Tage später
kam er wiederum auf den Tennisplatz und entschuldigte sich höflich bei
der Mutter. Er sagte, dass er es wohl mit seiner Migräne zu tun gehabt
haben müsse. Plötzlich kam Tropos, der ältere Sohn der Familie auf ihn
zu. In der Hand hielt er die Feder einer Taube. „Hier Herr Pirein, die
habe ich gefunden. Darf ich sie ihnen schenken?“ Pirein nahm die Feder
und fragte lächelnd: „Was soll ich denn damit?“ „Damit sie sich
etwas hinter die Ohren schreiben können!“ sagte der Junge. Die
anwesenden Personen fingen an zu lachen und das Lächeln gefror Pirein im
Gesicht.
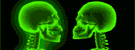
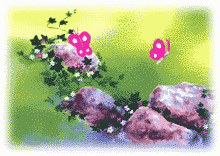
Autor: